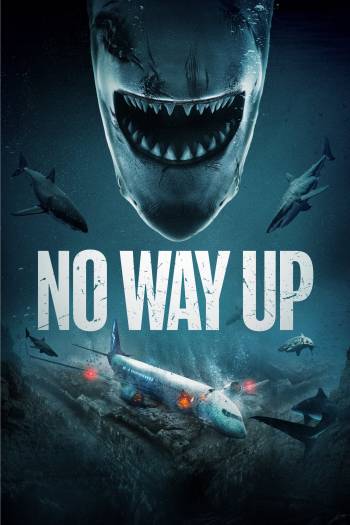Emily (2022)
Original-Titel: EmilyStarke Frauen aus dem 19. Jahrhundert: Mit „Emily“ bekommt eine der revolutionären Brontë-Schwestern ein filmisches Denkmal gesetzt.
Regie Emma Mackey
Emily Brontë Fionn Whitehead
Branwell Brontë Alexandra Dowling
Charlotte Brontë Oliver Jackson-Cohen
William Weightman Adrian Dunbar
Patrick Brontë Gemma Jones
Aunt Branwell Amelia Gething
Anne Brontë Veronica Roberts
Tabby Gerald Lepkowski
Mr. Linton Paul Warriner
Reverend Miller
Regie Emma Mackey
Emily Brontë Fionn Whitehead
Branwell Brontë Alexandra Dowling
Charlotte Brontë Oliver Jackson-Cohen
William Weightman Adrian Dunbar
Patrick Brontë Gemma Jones
Aunt Branwell Amelia Gething
Anne Brontë Veronica Roberts
Tabby Gerald Lepkowski
Mr. Linton Paul Warriner
Reverend Miller
Die Handlung von Emily
Im engstirnigen England des 19. Jahrhunderts haben es die Frauen nicht leicht. Tanzen sie kurz aus der Reihe, werden sie als sonderbar abgestraft und haben somit direkt einen schlechten Stand in der Gesellschaft. So ergeht es auch Emily. Größere Menschenmassen waren ihr schon immer ungeheuer und ein Leben fernab ihrer behüteten Heimat sorgen bei ihr direkt für Panik.
Doch die Zeiten, in denen sie sich mit ihren Schwestern Charlotte und Anne in Fantasiewelten austoben konnte, sind vorbei. Ihr Vater Patrick braucht nach dem Tod seiner Frau die finanzielle Unterstützung seiner Töchter. Während Charlotte sich schon längst dem Beruf der Lehrerin verschrieben hat, fällt es Emily weiterhin schwer, sich den Plänen ihres Vaters (und wenn man ehrlich ist, auch der von Männern dominierten Gesellschaft) zu fügen.
Gerne wäre sie solch ein Freigeist wie ihr Bruder Branwell, der sich lieber seinen Künsten und dem Alkohol hingibt. Doch der neue Pfarrer William Weightman könnte Abhilfe schaffen. Er soll ihr die französische Sprache beibringen, damit Emily wenigstens als Gouvernante arbeiten kann.
Er scheint Emily und ihre Fantastereien zu verstehen, weshalb Emily schon bald seinem Charme erliegt. Doch je vertrauter sich die zwei Menschen werden, desto problematischer wird es. Nicht nur wird diese persönliche Nähe von der Gesellschaft verpönt, auch muss Emily realisieren, dass William in Wirklichkeit Angst vor Emilys Ideen und Visionen hat.
Kritik zu Emily
Das frühe 19. Jahrhundert war für Frauen, insbesondere für diejenigen, die eine aufgeschlossenere Denkweise an den Tag legten, die reinste Farce. So war der Beruf des Schriftstellers beispielsweise ausschließlich den Männern vorbehalten. Dennoch gab es immer wieder Frauen, die sich gegen diese traditionellen Muster stellten.
Die Brontë-Schwestern Charlotte, Anne und Emily gehörten zu diesen „aufmüpfigen“ Frauen. Letztere bekommt dank Filmemacherin Frances O’Connor mit „Emily“ nun ein filmisches Denkmal gesetzt. Für O’Connor ist „Emily“ die erste Regiearbeit, doch schon in ihrer früheren Karriere als Schauspielerin wirkte sie bereits in ähnlichen Filmen mit („Mansfield Park“, „Madame Bovary“).
Für die Hauptrolle der eigensinnigen Emily hat sich O’Connor für Emma Mackey („Sex Education“) entschieden, die sich damit einer langen Liste an Darstellerinnen anschließt, die allesamt die ein oder andere starke Frau aus dem frühen 19. Jahrhundert verkörpert haben. Saoirse Ronan beispielsweise war eine der March-Schwestern in Greta Gerwigs „Little Women“, Anya Taylor-Joy spielte die Verkupplerin “Emma“ und Dakota Johnson wurde zur Titelfigur in „Überredung“.
Doch was grenzt O’Connors Werk von den anderen Produktionen ab? Generell ist „Emily“ in Gänze ein stimmiges Werk, was vor allem der eindrucksvollen Schauspielerei Mackeys und natürlich auch den atmosphärischen Aufnahmen zu verdanken ist. Das Problem, weswegen „Emily“ hier und da aneckt, sind die künstlerischen Freiheiten, die sich O’Connor bei ihrem Skript herausgenommen hat.
Die in „Emily“ angedeutete Liebesgeschichte zwischen Mackey und Oliver Jackson-Cohen („Spuk in Bly Manor“) ist frei erfunden. In der Biografie von Emily Brontë war nie die Rede von einer solch „skandalösen“ Liebschaft. Das peppt das Biopic zwar auf und zieht ein breiteres Publikum an, bietet gleichwohl aber auch eine große Angriffsfläche für Kritiker. Lohnt sich, weil O’Connor mit dieser Produktion ein erstaunlich gutes Erstlingswerk auf den Markt gebracht hat. Da können sich andere Regie-Newcomer gerne eine Scheibe von abschneiden.